Biographie „Betty Rosenfeld. Zwischen Davidstern und roter Fahne“ – Michael Uhl
Ein Geständnis vorab: Es war nicht leicht, am Ball – ähm … am Buch – zu bleiben. Betty „the Brick“ zu Ende zu lesen, war eine ganz schöne Herausforderung. Der Leseprozess hat sich über ein halbes Jahr hingezogen, schlichtweg weil das Buch zu schwer und zu dick ist, um es in meiner Handtasche zu transportieren. Das war insbesondere deshalb quälend, weil ich unbedingt weiterlesen wollte, es aber nur eingeschränkt konnte. Obwohl ich als Bibliophile sonst absolut Team Printbuch bin, wäre in diesem Fall mal wirklich die eBook-Variante sinnvoll gewesen. 
Die im Schmetterling-Verlag erschienene Biographie „Betty Rosenfeld. Zwischen Davidstern und roter Fahne“ wurde vom Historiker und Romanisten Michael Uhl in akribischer Recherchearbeit verfasst. So wie er in Stuttgart auf den Stolperstein von Betty Rosenfeld gestoßen ist, hat er mit seinem Werk ebenfalls ein Mahnmal geschaffen.
Der Verfasser zeichnet ein gelungenes historisches Portrait der jüdischen Krankenschwester aus Stuttgart. Er begleitet seine Protagonistin durch all ihre Lebensabschnitte bis hin zu ihrem tragischen Ende in Auschwitz. Dabei handelt es sich nicht um eine offensichtlich bekannte Persönlichkeit, sondern eher um das „Mädchen von nebenan“, das sich dazu entschließt, sich für ihre politischen Freiheitsideale einzusetzen.
Zunächst arbeitet sie für den kommunistischen Untergrund in Stuttgart, behält jedoch ihren jüdischen Glauben bei. 1935 wandert sie nach Palästina aus, doch als der Spanische Bürgerkrieg ausbricht, meldet sie sich für den Freiwilligeneinsatz beim Sanitätsdienst der Internationalen Brigarden, woraufhin sie in Murcia eingesetzt wird. Während sich die Macht des NS-Regimes ausbreitet, ist sie auf der Flucht durch Frankreich. Eine Verschiffung nach Übersee ist nicht möglich, sodass sie in einem franz. Lager interniert und 1942 schließlich nach Auschwitz deportiert wird.
Was mich sofort an dieser Biographie beeindruckt hat, sind die äußerst detaillierten Beschreibungen der Ereignisse und Gegebenheiten mitsamt der vielfältigen historischen Exkurse (z.B. über den Spanischen Bürgerkrieg).
Als Historiker:in ist es eines der größten Ziele, so nah an die historische Realität heranzukommen, wie es nur eben geht. Die frustrierende Nachricht ist: Es funktioniert nie zu 100 Prozent, wenn man diese Zeit nicht persönlich miterlebt hat. Und doch versucht man es immer wieder – das macht den Reiz der Forschung aus.
Dem Autor gelingt es durch fundiertes Quellenmaterial, Bettys Lebensumstände authentisch wiederzugeben, so als wäre er live dabei gewesen.
Da zum Thema Nationalsozialismus vermeintlich schon alles gesagt wurde, wird dieses dunkle Kapitel der Geschichte mittlerweile für abgeschlossen erklärt. Manchmal erging es mir in meinem Studium genauso, spätestens nach der Analyse des 278. Leichenfotos aus dem KZ und etlichen schlaflosen Nächten, in denen die Bilder in meinem Kopf rumspukten. Trotz meiner intensiven Forschungen blieb eine Frage bislang offen: Waren die Menschen damals andere als heute? Bis vor einiger Zeit hätte ich die Frage mit „Ja“ beantwortet, weil ich unsere moderne Gesellschaft für aufgeklärter, demokratischer, friedvoller hielt.
Wenn man jedoch einen Blick in die Ukraine oder in andere Kriegsgebiete wirft, ist die Frage aktueller denn je. Fachbegriffe wie „Mobilmachung“, „Annektierung“, „atomare Bedrohung“ haben sich von den Geschichtsbüchern in die Tagespresse eingeschlichen und sich schon nach kurzer Zeit wieder in unserem Alltagswortschatz verankert. Zudem gibt es immer weniger demokratische Länder, liberales Gedankengut der 68er wird im Keim erstickt. Oft wird behauptet, man könne aus der Geschichte lernen, doch wenn es drauf ankommt, werden immer die gleichen oder zumindest ähnliche Fehler begangen. 1914 dachte man auch, der 1. WK sei am Ende des Sommers vorbei …
Interview
von Gabriele Goßmann, veröffentlicht auf www.mengede-intakt.de am 27.12.2021
Auf eine Tasse Kaffee….
Heute mit:
… dem Mengeder Singer/Songwriter Hans Blücher,
der das unkomplizierte Zusammenleben verschiedenster Kulturen und Nationalitäten im Dortmunder Norden wie im Nordwesten der Stadt schätzt
Vorbemerkungen:
Der Mengeder Singer/Songwriter Hans Blücher (mit bürgerlichem Namen Torsten Huith) ist 45 Jahre alt, verheiratet und lebt seit 2015 mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen (5 und 8 Jahre alt) in Mengede, in einem Nachbarhaus von Freunden. Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist er in Kempten im Allgäu. In seiner Ausbildung im Musikhandel hat er Gitarren verkauft und danach ein Stipendium für ein Studium erhalten.Nach seiner abgeschlossenen Ausbildung und seinem BWL-Studium ist er 2003 in die Dortmunder Nordstadt in eine WG gezogen.
Seit 25 Jahren spielt der Liedermacher und Indie-Sänger in Bands und seit nunmehr 15 Jahren tritt er mit seinem Soloprogramm unter dem Künstlernamen Hans Blücher auf (www.hansbluecher.de).
Aktuell geht er mehreren selbstständigen Tätigkeiten nach. Neben der Musik arbeitet er in einem Designbüro und als Berater. Letztes Jahr hat er ein Crowdfunding-Projekt zum Thema Nordstadt gestartet, um Musiker zu unterstützen, die an dem Projekt mitgeholfen haben.
*****
In Ihrem neuen Album „Nordstadtsoul“ wird Regionalität groß geschrieben. Wer aus Dortmund oder Umgebung kommt, kann sich sofort mit den Textinhalten identifizieren (zumindest ging es mir so 😊.) Woher kommt der starke Bezug zur Nordstadt bzw. zum Ruhrgebiet? Vom Allgäu in die Nordstadt zu kommen, stelle ich mir nicht so einfach vor …
Die Nordstadt war meine erste Anlaufstelle im Ruhrgebiet, als ich arbeitsbedingt damals nach Dortmund gezogen bin. Ich habe dort in einer WG zusammen mit drei anderen Mitbewohnern in der Blücherstraße gewohnt. Daher kommt mein Künstlername, denn dieser Ort und diese Zeit haben mich geprägt, vor allem auch als Musiker. Die Nordstadt als Teil einer Großstadt war schon anders als meine Heimat. Insbesondere schätze ich an der Nordstadt die Vielfalt der Kulturen, die einzigartige Budenkultur und die bodenständige Mentalität der Leute im Ruhrgebiet. Ich habe mich hier von Anfang an wohl gefühlt … und bin geblieben.
Sie haben das Album als Crowdfunding-Projekt angelegt und beachtenswerterweise die gesamten Einnahmen an die Mitwirkenden weitergegeben. Wie kamen Sie auf diese Idee? Worin liegt der Unterschied zur herkömmlichen Produktion eines Albums?
Crowdfunding war mir zwar vorher schon ein Begriff, und das Konzept fand ich schon immer interessant, doch die eigentliche Idee, ein Album mittels Crowdfunding zu finanzieren, ist während Corona entstanden. Ich wollte den Beteiligten eine Unterstützung in Form eines Honorars bieten. Durch die Beteiligung ist das Endergebnis noch besser geworden, als wenn ich es alleine im Studio produziert hätte. Es ist zu einem Gemeinschaftsprojekt geworden, bei dem sich jeder, der sich finanziell beteiligt hat, mit einbringen konnte. Auch am Musikvideodreh zum Song „Kopenhagen“ waren viele Freunde und Unterstützer beteiligt. Eine Besonderheit war zudem, dass es zum Album auch Online-Exklusiv-Konzerte über Zoom gab. Ein wesentlicher Vorteil von Crowdfunding ist der persönliche Kontakt zu den Geldgebern und die Nahbarkeit.
Könnte Crowdfunding als neues Konzept für Musiker eine Lösung sein, um sich auf dem Musikmarkt zu etablieren?
Absolut! Es schafft neue Ressourcen und Chancen, um Projekte zu ermöglichen, die durch eine herkömmliche Herangehensweise vielleicht nicht umgesetzt werden können.
Aktuell gehen Sie im Rahmen eines musikalischen Workshop-Projektes im Dortmunder Konzerthaus der spannenden Frage nach, wie die Nordstadt klingt. Wie klingt sie für Sie persönlich? Was verbinden Sie mit dem Stadtteil und wie verarbeiten Sie Ihre Eindrücke in Ihren selbstkomponierten Songs?
Ich habe den Song „So klingt die Nordstadt“ für das „Konzerthaus Community Music“-Projekt komponiert (Mehr Infos zum Projekt: https://www.konzerthaus-dortmund.de/communitymusic/ und https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten/nachricht.jsp?nid=680965). Dieses Projekt verdeutlicht sehr gut, was die Nordstadt ist, denn hier finden sich Musikbegeisterte aus verschiedensten Lebensbereichen zusammen und machen schlichtweg Musik. Die Nordstadt ist vielseitig, bunt, klangvoll. Sie ist für mich ein Fest, das auf zweierlei Weise laut ist: Es herrscht ein hoher Lärmpegel, ist zugleich aber auch belebt.
Wie steht die Nordstadt mit Kopenhagen in Verbindung?
In dem Musikvideo zu diesem Titel fahre ich mit dem Fahrrad durch die Nordstadt. Kopenhagen als „Fahrradhauptstadt Europas“ gilt für mich als Vorbild, was den Ausbau von Fahrradwegen betrifft. Ich wünsche mir auch hier Fortschritte in diese Richtung.
Nordstadt und Nordwesten von Dortmund – lässt ja schon alleine vom Namen eine gewisse Ähnlichkeit erahnen, ebenso von der geografischen Lage. Sie kennen beide – Würden Sie dieser Einschätzung zustimmen können?
Trotz der unterschiedlichen Charakteristik der Stadtteile gibt es aus meiner Sicht durchaus Gemeinsamkeiten, beispielsweise das unkomplizierte Zusammenleben verschiedenster Kulturen und Nationalitäten.
Wie gehen Sie beim Komponieren vor? Entwickeln Sie zunächst einen groben Themenumriss, über den Sie einen Songtext schreiben wollen, oder haben Sie direkt konkrete Lyrics und Melodien im Kopf? Oder anders gefragt: Was ist zuerst da, der Klang oder der Text? Und wie fügen Sie dann beides zu einer stimmigen Symbiose zusammen?
Wenn ich ein Thema gefunden habe, das mich zu einem Song animiert, entsteht bei mir zuerst die Idee, dann die ersten Textzeilen und zum Schluss die Melodie. Wenn der Chorus steht, hat man das Grundgerüst geschaffen, woraufhin man sich den Feinheiten widmen kann. Aber ich würde mich nicht als zu perfektionistisch bezeichnen. Ich schreibe lieber mehrere Songs, anstatt an nur einem einzigen jahrelang zu sitzen.
Als Singer/Songwriter oder als Künstler generell hat man es nicht immer leicht in der Gesellschaft – und insbesondere jetzt während der Pandemie. Haben Sie es je bereut, in die Musikbranche eingestiegen zu sein?
Kunst und Kultur waren seit Beginn der Pandemie beinahe vollkommen ausgeschaltet. Daher ist es gerade jetzt wichtig, in einen (musikalischen) Austausch zu kommen, denn die Kunst ist es, die das Leben so richtig lebenswert macht. Ich bereue es keinesfalls, mich mit Musik zu beschäftigen. In Coronazeiten neigt man leicht dazu, nur noch zu existieren. Dabei bietet einem der Umgang mit Musik so viel.
Und was genau gibt Ihnen die Musik?
In erster Linie Energie, Trost und Zuversicht – und die Möglichkeit, meine Emotionen auszudrücken.
Beruflich bewegen Sie sich in zwei sehr unterschiedlichen Bereichen: Zum einen haben Sie BWL studiert und zum anderen geben Sie sich der Kunst hin. Sehen Sie dies als Widerspruch in sich? Betrachten Sie es (heutzutage) als unumgänglich, mehrere Standbeine zu haben, anstatt ausschließlich von der Musik zu leben?
In beiden Bereichen konnte ich viele mir heute nützliche Erfahrungen sammeln. Ich finde es wichtig, als Musiker heutzutage mehrere berufliche Standbeine zu haben. Das nimmt mir zumindest den Druck, nur von der Musik leben zu müssen und gibt mir ein Stück Sicherheit. Andererseits bedeutet es mir viel, flexibel arbeiten zu können, anstatt einem 40-Stunden-Job nachzugehen, der mir keine Freude bereitet.
Natürlich wäre es aber schön, wenn es mehr Menschen ermöglicht werden könnte, ihren Lebenstraum zu erfüllen. Mein Wunsch ist, dass es eine stärkere Förderung für musikalische oder auch künstlerische Talente gibt.
Was haben Sie für Vorstellungen für die Zukunft?
Zentrale Aspekte für die Gestaltung der Zukunft sind ein achtsamer Umgang miteinander und mit unserer Erde, die Bewahrung der Natur, Umweltschutz, autofreie Innenstädte und die Vermeidung, unsere natürlichen Ressourcen weiterhin auszubeuten.
In Bezug auf die Medienlandschaft wäre mehr Transparenz in der Berichterstattung wünschenswert. Z.B. könnte viel mehr über die Erfolge berichtet werden, die z. B. im Klima- und Umweltschutz bereits erreicht wurden. Das spornt die Leute doch noch mehr an, als wenn sie immer nur Negativschlagzeilen zu lesen bekommen.
Ist es Ihnen wichtig, dass Ihre Kinder ebenso wie Sie musikalische Fähigkeiten entwickeln?
Ich würde mich zwar darüber freuen, wenn meine Kinder sich ebenso wie ich für Musik begeistern würden, aber noch viel wichtiger ist für mich, dass sie eine nachhaltige, solidarische Kooperation fürs Zusammenleben entwickeln können. Dabei möchte ich sie gerne unterstützen. Im Moment arbeite ich an einem neuen Song mit dem Titel „Parents4Future“, inspiriert durch den gleichnamigen Verein. Es ist eines meiner großen Anliegen, auch die Erwachsenen zu mehr Nachhaltigkeit zu motivieren.
Wie sehen Sie explizit die Zukunft der Musik?
Speziell als Künstler frage ich mich insbesondere, für welche Werte ich heute und morgen stehe. Musik hat einen verbindenden Charakter, beispielsweise durch gemeinsames Singen zu Weihnachten. Musik geht eine Ebene tiefer als bloße Fakten. Sie besitzt eine starke Ausdruckskraft, welche man auch in Zukunft nutzen sollte, um seine Werte zu vermitteln.
Gibt es noch weitere Projekte, an denen Sie derzeit arbeiten?
Wenn es um Musik geht, bin ich ständig mit etwas beschäftigt. Vor allem aus Alltagssituationen schöpfe ich meine Kreativität. Zusammen mit Klaus Neuvians ist im Rahmen dieses Interviews die spontane Idee entstanden, ein Album über Mengede und mit Mengeder Musikern zu vertonen. Ich habe auch schon einige Zeilen und den Titel im Kopf. Eines kann ich schon jetzt verraten: … da ist Musik drin.
Sich neu verbinden – aber wie?
Eine Bilanz zur Frankfurter Buchmesse 2021
Re:connect – das Motto der Messe
Die 73. Frankfurter Buchmesse fand nach einer Corona-Pause erstmals wieder als Präsenzmesse statt. Vom 20.-24.10. präsentierten Aussteller aus über 70 Ländern ihre Bücher und Dienstleistungen unter einem strengen Hygiene-Konzept. Für die Besucher galten die 3-G-Regel und die Maskenpflicht, und zudem gab es diesmal ausschließlich Online-Tickets zu kaufen.
Das Motto der diesjährigen Buchmesse lautete „Re:connect – Welcome back to Frankfurt“, digital und vor Ort. Nach einer langen Phase der coronabedingten „Vereinzelung“ des Individuums in der Gesellschaft entstand auch in der Buchbranche der Wunsch nach Wiederaufnahme eines persönlichen, kulturellen Austausches. Die Buchmesse 2021 sollte dies ermöglichen – am literarischen Leben aktiv teilzunehmen, sich wieder mit Gleichgesinnten zu vernetzen.
Nachdem es letztes Jahr ersatzweise eine rein digitale Messe gab, wollte man dieses Jahr das Konzept einer digitalen Vernetzung weiterhin aufrechterhalten und noch weiter ausbauen. Daher wurden die Veranstaltungen der ARD-Bühne in der Festhalle, das Bookfest City in der Innenstadt und das Frankfurt Studio Festival vom Buchjournal auf dem Messegelände auch als Livestream übertragen. Weitere Neuerungen waren diesmal auch, dass die Messe für Privatbesucher schon ab Freitag zugänglich war und der Schwerpunkt am Wochenende auf dem Buchverkauf lag.
Die Veranstalter der Messe mussten sich den aktuellen Herausforderungen zur Überwindung der Pandemie stellen. Neben den finanziellen Problemen in der Buchbranche und der akuten Papierknappheit wurde zudem die Anwesenheit des neurechten Jungeuropa-Verlages äußerst kontrovers betrachtet. Schon vorab kam es zu einer Reihe von Absagen bekannter Autor:innen und zu Boykottaufrufen in den sozialen Medien. Dadurch wurde das Motto der Verbindung eher ins Gegenteil verkehrt: sich spalten.
Bücher verbinden – aktuelle Neuerscheinungen zu brisanten Themen
Trotz der Schwierigkeiten boten die auf der Messe präsentierten Bücher erste Lösungsansätze. Unter der zentralen Frage „Wie wollen wir leben?“ – insbesondere nach der Corona-Krise – wurden im Veranstaltungsprogramm die verschiedensten aktuellen Themen und Stimmungen aufgegriffen und diskutiert, darunter die Gesellschaftsordnung, der Klimawandel und der Kulturkampf um Diversität. Auch Frauenliteratur war stark vertreten. Während der Corona-Pandemie ist ein spezieller Begriff entstanden, der Ausdruck von einem sich immer mehr herauskristallisierenden weiblichen Stimmungsbild sei: viele Frauen seien zunehmend „mütend“, ein Gefühlsgemisch aus Wut und Müdigkeit – sei es aus politischer Unterdrückung oder aus Erwartungsdruck. Neuerscheinungen im Sachbuchbereich, die dieses Empfinden treffend beschreiben, sind u.a. Ciani-Sophia Hoeders Buch „Wut und Böse“, Ann-Kristin Tlustys „Süß“ und Franziska Schutzbachs Titel „Die Erschöpfung der Frauen“. Ein weiteres gesellschaftliches Thema stand im Fokus des Diskurses, und zwar die kapitalistische Krise, die zum großen Teil auch als Resultat der Coronakrise gilt. Darüber hinaus werfen die Autorinnen Silke van Dyk und Tine Haubner in ihrem Buch „Community-Kapitalismus“ einen kritischen Blick auf eine besorgniserregende Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: Freiwillige unbezahlte Arbeit, z.B. in Krisensituationen wie der Flutkatastrophe in diesem Sommer, werde dazu genutzt, um Lücken der staatlichen Versorgung zu schließen.
Das Gastland Kanada – mit der Natur verbunden
Das Gastland Kanada präsentierte sowohl im Ehrengast-Pavillon als auch parallel online unter dem prägnanten Motto „Singular Plurality“ seine vielfältige kulturelle Identität. Während in den übrigen Messehallen ein konstantes Stimmengewirr herrschte, es mit der Zeit stickig unter der Maske wurde und das Entlangschlendern in den Gängen anstrengend wurde (vor allem, wenn man sich an der gefühlt kilometerlangen Warteschlange am Lyx-Stand vorbeiquetschen musste), weil man das Menschengedränge gar nicht mehr gewöhnt war, überkam einen ein beruhigendes Gefühl, als man die kanadische Ausstellung betrat. Am Eingang befand sich ein nachgebildetes Gebirge, umhüllt von einer marmorartigen Oberfläche. Folgte man den Wegen, traf man auf ein wellenartiges Gebilde, das dem Himmel ähnelte und eines, das Pflanzenstrukturen glich, und weiter kam man an einen Fluss, in dem Buchstaben flossen. Aus den Elementen der Natur entspringt die Sprache. Mit dieser imposanten, wellengeformten Naturinstallation wurde der instinktive Wunsch des Menschen aufgegriffen, sich wieder auf die Ursprünge zurückzubesinnen.
Connections im Selfpublishing knüpfen – persönliche Eindrücke
Für mich persönlich war die Frankfurter Buchmesse – auch wenn sie kleiner war als sonst – in diesem Jahr ein besonderes Ereignis. Nicht nur deshalb, weil es die erste Messe seit längerer Zeit war, sondern auch, weil meine beiden Selfpublishing-Bücher ausgestellt wurden. Die Bücher in den Regalen stehen zu sehen, war für mich ein sehr emotionaler Moment, denn davon hatte ich, seitdem ich in meiner Schulzeit das erste Mal zusammen mit meinem Vater auf der Buchmesse war, geträumt. Auf meiner ersten Messe damals habe ich eine tief verwurzelte Bindung zu den Büchern gespürt und die Literaturschaffenden bewundert. Ab diesem Moment war mir klar: Ich will auch ein Teil dessen sein – nur wie?
Damals waren mir die meisten Verlage, Autoren und Bücher noch fremd. Im Laufe der Jahre hat sich mein literarischer Horizont erweitert und zugleich hat sich auch der Buchmarkt an sich weiterentwickelt. Was früher erst im Entstehungsprozess war, hat sich heute inzwischen etabliert: die Möglichkeit des Selfpublishing. Wenn man ein Buch im Selfpublishing herausbringt, ist es von größter Wichtigkeit, Kontakte zu knüpfen, sich mit anderen zu vernetzen – aber wie?
Gerade durch das strenge Hygiene-Konzept wurde es den Autoren erschwert, sich zu connecten, denn Gruppenbildungen an den Ständen waren ausdrücklich nicht erwünscht. Außerdem ist es nicht so wie bei Verlagsautoren, die von vielen erkannt werden. Es bringt also wenig, wenn man so etwas sagt wie „Hallo, hier bin ich.“ Und so habe ich mich an den Stand des Selfpublishing-Verbandes gestellt und gewartet, in der Hoffnung, dass mich jemand anspricht. Und tatsächlich! Eine Frau hat mich unter ihrer Maske freundlich angelächelt, ist auf mich zugekommen und hat das Gespräch zu mir gesucht. Wir haben uns mit Mimik und Gestik verbunden. Danach war das Eis gebrochen. Ein Mann, der beobachtet hatte, dass ich mein Buch dort ausgestellt habe, fragte mich, wie das so abläuft mit dem Selfpublishing. Ich erzählte ihm meine bisherigen Erfahrungen.
Nach der Messe war ich erschöpft, aber zugleich zufrieden. Und ich dachte: Verbindung ist doch möglich. Sie ist der Anfang von etwas Neuem.
Interview mit dem bekannten Krimiautor Max Annas über seinen neuen Roman „Der Hochsitz“
Max Annas lebt als Schriftsteller in Berlin. Er hat vor 2014 etwa ein Dutzend dokumentarischer Bücher veröffentlicht und seither sieben Romane, die in Südafrika, der DDR, der BRD, dem sogenannt wiedervereinigten Deutschland und in einem Deutschland der Zukunft spielen. Für einige der Romane hat er den Deutschen Krimipreis erhalten.
In einem schriftlich geführten Interview gibt er einen interessanten Einblick in die Entstehungshintergründe seiner Neuerscheinung „Der Hochsitz“ und verrät sein persönliches Erfolgskonzept für (s)eine Schriftstellertätigkeit.
Ein einziger Ratschlag: Schreiben, schreiben, schreiben…
„Na, man denkt doch, hier passiert nichts. Das ist das Ende der Welt.“ (E-Book, S. 444) Das behauptet einer Ihrer Charaktere über den Ort der Handlung – ein kleines Dorf in der Eifel. Dass es garantiert nicht so ist, zeigt sich schon gegen Anfang der Geschichte. Im Gegenteil, es passiert eine Menge in der vermeintlichen Idylle. Möchten Sie uns einen kleinen Einblick in die Thematik Ihrer Neuerscheinung geben? Worum geht es?
An der Oberfläche ist DER HOCHSITZ ein Buch, das auf die Eifel im Jahr 1978 blickt. Zwei 11-jährige Mädchen erleben Dinge, die sich außerhalb dessen abspielen, was sie zu verstehen in der Lage sind – Politisches und Zwischenmenschliches aller Art, vom Schmuggel bis zur RAF, von Sex bis zum Mord. Sie haben Osterferien, viel Zeit und bauen sich aus dem, was sie sehen, eigene Bilder. Unterhalb dessen geht es um die Frage, wie wir uns erinnern, an was wir uns erinnern, und wie wir unsere eigene Vergangenheit erzählen, in diesem Fall also die westdeutsche. Wie beziehen wir uns auf den Alltag in der BRD? Das ist durchaus auch ein Kommentar auf nostalgistisches und konservatives Reden sowie die wenig fruchtbare Haltung, alles möge so bleiben, wie es ist.
Der Spannungsbogen baut sich konsequent auf, indem verschiedene Erzählstränge parallel laufen und in einem Knotenpunkt gebündelt werden: dem Hochsitz. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen Krimi über einen Hochsitz zu schreiben? Hat dieser – abgesehen von der Funktion als Knotenpunkt – auch eine metaphorische Bedeutung?
Meine Partnerin ist genau dort, wo die meisten Kapitel von DER HOCHSITZ spielen, aufgewachsen. Die Kapitel, die sich mit den Fußballsammelbildern zur WM in Argentinien beschäftigen, und die Episode mit dem geklauten RAF-Fahndungsplakat sind dokumentarisch. Das war der Auslöser für den Roman. Ich brauchte neben den Mädchen als emotionales Zentrum des Buches noch einen geografischen Fixpunkt, der mit ihnen zu tun hat. Und dieser Ort musste schon die Schlauheit der Protagonistinnen repräsentieren. Eine Höhle hätte es da nicht getan. Die Höhle wäre was für Jungs gewesen, und sie hätte nicht den weiten Blick geboten, den die Mädchen ersehnen. Darin steckt Neugier, Wissenwollen und natürlich auch Aufbruch.
Viele Autoren möchten sich in ihren Werken durch ihren Sprachstil profilieren. Sie hingegen schreiben in Ihrem neuen Krimi u.a. aus der Sicht eines elfjährigen Bauernmädchens aus der Eifel. Dies erfordert sicher Mut, schafft aber zugleich ein hohes Maß an Authentizität der Charaktere. Hat sich Ihr prägnanter Sprachstil erst im Laufe Ihrer Schriftstellerkarriere entwickelt oder hatten Sie von Anfang an eine klare Vorstellung davon, wie Sie schreiben wollen?
Das Schreiben ist in steter Entwicklung. Und Schreiben ist das Einzige, was ich je gelernt habe. Reduktion also auch eine Konsequenz aus vielen, vielen Versuchen in vielen, vielen Gattungen. Das Einlassen auf Figuren wiederum – also im Fall von DER HOCHSITZ auf zwei 11-jährige Mädchen, ist eine Kernvoraussetzung der Fiktion. Dabei ist es gar nicht so vermessen, dass ich versuche, den Blick dieser beiden jungen Menschen im Schreiben auszuloten. Immerhin war ich im Jahr 1978 ähnlich alt, oder jung, wie die beiden Protagonistinnen. Da beginnen die Gemeinsamkeiten. Ich kann das auch konfrontativer formulieren: Die Figur eines mir gleichaltrigen Mannes kann Erfahrungen gemacht haben, die ich nicht oder nur mit viel mehr Mühe in der Lage bin zu beschreiben. Sei es, da er in einer ganz anderen Weltgegend verortet ist oder in einer anderen Zeit. Oder gar beides.
Ihr Roman spiegelt originalgetreu das Lokalkolorit der Eifel wider. Sind Sie selbst auf dem Land aufgewachsen oder haben Sie einfach nur gut recherchiert?
Ich bin sehr vorsichtig, wenn es um eine solche Einschätzung geht. Dass etwas originalgetreu sei, hört sich sehr schön an, aber letztlich resultiert das aus der Wahrnehmung einer Anzahl an Ideen und Bildern. Dokumentarismus ist schließlich nicht mein Ding. Ich halte sämtliche Figuren im Schwitzkasten, also einer Situation, die Alltag verneint um des Dramas willen. Wenn dabei allerdings der Eindruck entsteht, dass ich mich auf Gegend und Zeit eingelassen habe, dann freut mich das sehr.
In Ihren Krimis behandeln Sie oftmals historische Themen, insbesondere die Geschichte der DDR. Wie arbeiten Sie die historischen Quellen für Ihre fiktiven Erzählungen auf?
Ich bleibe schon nahe an eigenen Erfahrungen. Die Bücher, gleich ob sie in Südafrika spielen oder in der DDR, haben mit Bildern zu tun, die ich gesehen und lange in mir getragen habe. Die DDR zum Beispiel habe ich in den letzten Jahren ihrer Existenz so oft wie möglich besucht. Das ist – wie in anderen Fällen auch – eigentlich immer der Start für etwas, eigene Bilder. Darauf aufgebaut beginnt ein Schreibprojekt dann zu leben. Aber natürlich ist Recherche ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Die Polizeiarbeit in der DDR zum Beispiel musste ich in Gesprächen und durch die Lektüre einiger Bücherberge erst einmal für mich umreißen, bevor ich zu schreiben angefangen habe. Immer gibt es Leute, die für mich nachlesen, was ich produziert habe, im Falle der DDR zum Beispiel solche, die dort aufgewachsen sind, und die mich auf Fehler hinweisen, die tatsächlich nur indigenes Wissen bemerkt.
Sie haben sich neben der Veröffentlichung von Sachbüchern als Krimi-Autor einen Namen gemacht, wenn man das so sagen darf. Können Sie sich vorstellen, auch mal andere Genres zu bedienen, z.B. Science-Fiction, Fantasy oder Lyrik?
Es ist schon ausgeschlossen, dass sich einst Elfen und Trolle in meinen Romanen bewegen werden. Das heißt aber nicht, dass Entwicklung nicht stattfinden darf und soll. Da denke ich eher von Buch zu Buch. Genretreue – im Sinn von Verbeugungen vor Konventionen und Mustern – zeige ich ja auch heute nicht. Doch generell fühle ich mich gut aufgehoben im Krimiregal. Und einen Gedichtband (von mir) will ich niemandem zumuten.
Gab es Momente in Ihrer Laufbahn als Redakteur und Schriftsteller, in denen Sie an der Buchbranche gezweifelt oder Rückschläge erlebt haben? Falls ja – warum? Und gab es etwas, das Sie daraus gelernt haben? Was würden Sie Nachwuchsautoren raten, wie man sich auf dem Literaturmarkt am besten etablieren kann?
Ich habe Schreiben immer als nicht endenden Versuch betrachtet, da stecken Zweifel (am selbst und dem Wirtschaftszweig) schon drin. Aber weil es eben das ist, ein ständiger und nicht endender Versuch, gibt es nichts anderes, als am nächsten Morgen einfach weiterzumachen. Die Sache mit dem Etablieren ist dann auch nichts, was ich mit einem Ratschlag versehen kann. In den allermeisten Fällen, auch bei mir, ist eine gehörige Portion Glück dabei, wenn Dinge klappen. Ein gutes Buch UND Glück. Der einzige Ratschlag geht vielleicht so: Schreiben, schreiben, schreiben.
Allgemeine Infos zur Neuerscheinung: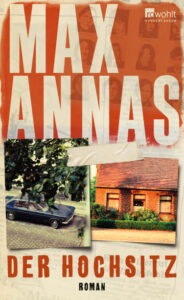
Titel: Der Hochsitz: Roman
Autor: Max Annas
Verlag: Rowohlt
Seitenzahl: 272
ISBN-13: 978-3498002084 (gebundene Ausgabe)
Erscheinungsdatum: 20. Juli 2021
Preis: 22,00 €
Interview
von Gabriele Goßmann, veröffentlicht auf www.mengede-intakt.de am 28.09.2021
„Jugend & Amt“ – Buch-Neuerscheinung aus Westerfilde
Dolf Mehring in einem aufschlussreichen Interview über Jugend, Amt und Jugendamt
Der in Bochum geborene und in Westerfilde wohnende Dipl.-Sozialpädagoge Dolf Mehring ist den Mengedern bestimmt bereits durch sein maßgebliches, aktives Engagement im „Freundeskreis Wiesengrund“ in Westerfilde bekannt. Als jahrelanger Leiter des Jugendamtes Bochum hat er nun nach zweijähriger intensiver historischer Forschungsarbeit auf der Basis seiner Expertise und praktischen Erfahrungen ein äußerst lesenswertes Buch zum Thema Kinder- und Jugendhilfe im Ruhrgebiet herausgebracht.
Veröffentlicht hat er das Sachbuch im Selfpublishing bei BoD. Die Arbeit ist auf insgesamt zwei Bände angelegt. Der frisch erschienene Band 1 behandelt die Zeit vom Mittelalter bis 1945.
Erhältlich ist das Print-Buch in sämtlichen Onlineshops (im BoD-Shop, bei Amazon & Co.) und auch vor Ort in Mengede in der Buchhandlung am Amtshaus.
Im folgenden Interview legt der Autor anschaulich die Hintergründe zur Geschichte des Jugendamtes in Bochum und Umgebung dar und gibt einen Einblick in den Entstehungsprozess seines Buches:
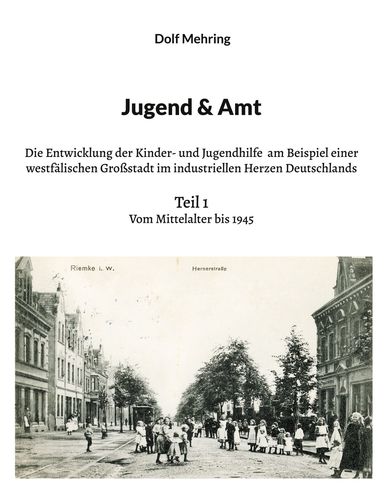
Was hat Sie dazu veranlasst, eine Forschungsarbeit zum Thema Kinder- und Jugendarbeit zu verfassen und welche neuen Impulse bietet Ihre Arbeit im Vergleich zur bisherigen Forschungsliteratur?
Ursprünglich nahm ich 2019 das bevorstehende Jubiläum des 100jährigen Bestehens des Bochumer Jugendamtes – dort war ich 18 Jahre lang als Leiter tätig – zum Anlass, die Geschichte dieses Amtes aufzuarbeiten.
Schnell stellte ich bei meinen ersten Nachforschungen fest, dass es nicht damit getan war, eine kurze Entstehungsgeschichte zu verfassen. Denn das hätte keinesfalls die Frage beantwortet, warum es 1920/21 sowohl in Bochum als auch in Dortmund zur Gründung von Jugendämtern kam. Um diese Frage zu beantworten, musste ich viel weiter zurück in die Geschichte gehen … aus einem anfänglich kleinen Geschichtsprojekt wurde eine richtig spannende Forschungsarbeit, die für mich viele neue und auch überraschende Erkenntnisse brachte. Mir wurde beispielsweise deutlich, dass die bisherige Forschungsliteratur wenig bis nichts über die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Ruhrgebiet bietet.
Meine Arbeit setzt ergänzend zu bisher bekannten Veröffentlichungen folgende neuen Impulse:
a) der bedeutende Einfluss der (Berg-)Arbeiterbewegung auf die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
b) die äußerst wichtige Rolle, die die Dortmunderin Agnes Neuhaus auch auf Reichsebene hatte, um das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz auf den Weg zu bringen
c) die Erkenntnis, dass die Vorläufer der Jugendämter im Ruhrgebiet gleichzeitig oder sogar vor den in der Fachliteratur oft erwähnten Pilotjugendämtern in Mainz und Hamburg entstanden (das Waisen- und Fürsorgeamt in Bochum z.B. bereits 1906)
Schon der Titel Ihrer Forschungsarbeit klingt ansprechend: Er lautet nicht etwa „Jugendamt“, sondern „Jugend & Amt“. Inwiefern ist diese Trennung maßgebend für Ihre Auseinandersetzung mit dem Thema?
Tatsächlich ergab sich die Bezeichnung ‚Jugendamt‘ aus der Zusammenführung zweier Begriffe! Der Begriff ‚Jugend‘ entstand ca. 1880 und war zunächst stark negativ besetzt. Bis etwa 1910 vollzog sich eine Wandlung. ‚Jugend‘ wurde nun als dynamische, zukunftsorientierte Kraft definiert. Das war eine Folge der Entstehung der ersten deutschen Jugendbewegung – den Wandervögeln – in Deutschland. Die Bezeichnung ‚Amt‘ gab es hingegen schon im Mittelalter. Dort waren Beauftragte für den jeweils herrschenden Machthaber tätig, die anders als Polizei oder Militär mit friedlichen Mitteln für Ordnung und die Entwicklung des Gemeinwohls Sorge zu tragen hatten. Tatsächlich wurden unter dem neuen Namen ‚Jugendamt‘ zwei völlig unterschiedliche Welten zusammengeführt. Dieses durchaus inspirierende aber auch kritische Spannungsverhältnis prägt die Arbeit der Jugendämter bis heute. Daher habe ich in meinem Buch ‚Jugend & Amt‘ die Entwicklungen beider Welten durchgehend bis in die Neuzeit dargestellt: Wie veränderten und entwickelten sich ‚die Jugend‘ einschließlich der Kindheit auf der einen Seite und ‚das Amt‘ auf der anderen Seite?
Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass sich dieses Spannungsverhältnis positiv entwickelte, wenn das Amt dafür Sorge trug, Kindern und Jugendliche gute Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Kritisch wurde es, als es ein großes staatliches (und militärisches) Interesse gab, auf die ‚Jugend‘ gezielt Einfluss zu nehmen, sie dirigistisch zu steuern und zu lenken. Das war vor allem in Preußen und besonders in der Nazizeit der Fall.
Wie sind Sie bei der Aufbereitung der historischen Quellen vorgegangen? Sie gehen explizit nicht chronologisch vor, sondern orientieren sich an den sog. „vier Ur-Genen“ – Was kann man sich darunter vorstellen und warum haben Sie sich für diese Art der Gliederung entschieden?
Eine Chronologie der historischen Ereignisse hätte wenig dazu beigetragen, die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe verstehen zu können. Deshalb ging es mir um den Erhalt von Zusammenhängen: Warum gab es diese Entwicklung in dieser Zeit? Ich habe es daher vorgezogen, zusammenhängende Geschichte(n) in einzelnen Abschnitten nebeneinander zu stellen. Beispielsweise der wirklich erstaunliche Fußmarsch des Colonen (Kötter) Gisbert Alef von Westerfilde nach Paris, der sich erfolgreich bei Napoleon für die Abschaffung der Leibeigenschaft einsetzte. Was für eine Leistung – die heute kaum gewürdigt wird und nahezu vergessen ist.
Diese Geschichtserzählungen überlappen zwar manchmal zeitlich, aber die Lesenden können nachvollziehen, warum sich einzelne Entwicklungen so und nicht anders vollzogen. Und tatsächlich wird es auch immer gesellschaftliche Realität gewesen sein, dass die Kenntnis von der Arbeit, die andere Gruppierungen leisteten, zuweilen nicht stark ausgeprägt war. Im Ergebnis konnte ich aber feststellen:
Anders als landläufig angenommen und auch in der Fachliteratur bisweilen dargestellt, ist die Geschichte der Kinder- und Jugendhilfe nicht ausschließlich christlich geprägt. Ich habe vier Ur-Gene herausgearbeitet, die alle größte Bedeutung für die weitere Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe hatten: Neben den christlich geprägten Barmherzigkeits- und Samaritergedanken waren das der (revolutionäre) Kampf der Arbeiter gegen Ausbeutung und für die Rechte von Kindern und Jugendlichen, das staatstragend motivierte sozial- und ordnungspolitische Handeln, sowie die Frauenbewegung, die maßgeblich die Entwicklung der Sozialarbeit als Frauenberuf vorangetrieben hat. Die unterschiedlichen Entwicklungen in diesen vier Genfamilien habe ich jeweils in sich geschlossen dargestellt und erläutert. Tatsächlich haben sich die Akteure, die den unterschiedlichen Ur-Genen zugeordnet werden können – wenn sie voneinander wussten – stark abgegrenzt. Doch auch das bewirkte, dass sie sich in hohem Maße gegenseitig beeinflussten. Ohne Karl Marx und Friedrich Engels wäre beispielsweise die katholische Soziallehre und deren Anerkennung der Klassenlage (Kapital und Arbeit) nicht entstanden.
Für uns ist es heutzutage selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche geschützt werden, doch das war nicht immer so. An einer Stelle zitieren Sie den preußischen Konsistorialrat Grashof, der sich über die Lage von Kinderarbeit zur Zeit der Industriellen Revolution wie folgt äußert: „Kinder von 6 Jahren werden bereits hinter die Maschinen gestellt, um dort selbst zu Maschinen zu werden. Man durchlaufe nur die Werkstätten und blicke das sieche verkrüppelte Geschöpf an, das sich Mensch nennt.“ (S. 77) Diese Erkenntnis ist erschreckend!
Wie kam es im weiteren Verlauf der Geschichte dazu, dass der Fokus hin zum Wohl der Kinder verschoben wurde?
Das Wohl des Kindes wurde zwar bereits im 19. Jahrhundert immer wieder thematisiert und vor allem von der Arbeiterbewegung eingefordert. Doch die gesetzlichen Initiativen zum Verbot der Kinderarbeit und Schutzbestimmungen für jugendliche Arbeiter wurden ausgehebelt und umgangen. Es ist das Verdienst der Arbeiterbewegung, dass sie mit ihren Initiativen dafür gesorgt hat, dass Anfang des 20. Jahrhunderts eine Kinderschutzbewegung entstand, die die Einhaltung des Kinderschutzgesetzes (1903) überwachte und kontrollierte. Diese sozialistisch geprägten Kinderschutzkommissionen waren später die Keimzellen der Arbeiterwohlfahrt.
Jugendhilfe und Geschlecht – gibt es einen Zusammenhang? Aus Ihrer Arbeit geht hervor, dass es oft Frauen waren, die sich für das Wohl der Kinder und Jugendlichen eingesetzt haben, sei es aus religiösen, emanzipatorischen oder politischen Gründen.
Der Zusammenhang ist ziemlich eindeutig. In den unterschiedlichen ‚Gen-Familien‘ waren es häufig besonders aktive Frauen, die sich ganz praktisch um die Belange der Kinder und Jugendlichen bemühten: Ob es die barmherzigen Schwestern des Vincenz von Paul oder Agnes Neuhaus, Käte Duncker oder Klara Zetkin, aktive Frauen im Vaterländischen Frauen Verein, Jeanette Schwerin und Alice Salomon aus der emanzipatorischen Frauenbewegung waren … sie alle prägten die Entwicklung der Sozialarbeit in entscheidendem Maße. Viele dieser Frauen stammten aus dem Bürgertum. Sie sahen sich – zum Teil ausgestattet mit sehr guter Schulbildung – unterfordert und wollten nicht ausschließlich ein Schattendasein als gut verheiratete Ehefrau führen. Da ihnen eine eigene berufliche Entwicklung verwehrt war, entwickelten sie die soziale Arbeit als Frauenberuf. In der Fachliteratur wird auch von der ‚Mütterlichkeit als Beruf‘ gesprochen.
Alice Salomon vergleicht – wie Sie anschaulich darlegen – 1926 die Arbeit des Sozialarbeiters mit der eines Arztes. Während der Arzt die Symptome einer Krankheit auswerte, habe der Sozialarbeiter die Aufgabe, Symptome sozialer Missstände auszuwerten (S. 286). Ist diese Ansicht bis heute aktuell? Wie definieren Sie die heutigen Kernaufgaben eines Sozialarbeiters?
Die Aufgabe, Symptome sozialer Missstände auszuwerten, ist heute nach wie vor aktuell. Ich nenne das Beispiel der heutigen Kinderarmut. Selbstverständlich ist es Aufgabe der Sozialarbeit, sich besonders um benachteiligte Kinder zu kümmern und Ihnen Bildungs- und Teilhabechancen zu ermöglichen. Gleichzeitig darf Sozialarbeit aber nicht vergessen zu analysieren, warum es zur massenhaften Kinderarmut in unserer Gesellschaft kommt. Die Ursachen dafür zu benennen und sich in unserer Gesellschaft gegen strukturelle Bedingungsfaktoren von Kinderarmut einzusetzen, gehört mit zur Aufgabe von Sozialer Arbeit. Das macht die Arbeit konfliktreich. Wer nur an den Symptomen herumdoktert, hat das Wesen der sozialen Arbeit nicht verstanden. Grundsätzliche Kernaufgabe des Sozialarbeiters heute ist es, sich immer für das Recht auf Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen einzusetzen, um sie zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit werden zu lassen. Dazu gehört, mit dazu beizutragen, dass positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien geschaffen werden. Sozialarbeit hat dafür Sorge zu tragen, eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu schaffen. Diese grundsätzlichen Zielstellungen sind übrigens ausdrücklich im § 1 des VIII. Sozialgesetzes festgelegt und damit heute eine rechtsverbindliche Handlungsgrundlage jedes Sozialarbeiters im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.
Wie würden Sie Ihre jahrzehntelangen Erfahrungen in der Branche beschreiben? Welche persönlichen Erkenntnisse haben Sie aus Ihrer Arbeit als Sozialpädagoge in der Kinder- und Jugendhilfe gewonnen?
Ich habe Kinder- und Jugendarbeit sowohl ehrenamtlich als Jugendlicher als auch nach meinem Studium hauptberuflich betrieben. Von der Pike auf: Ehrenamtlich in der katholischen Jugendarbeit (KjG), dann beruflich in einem Kindergarten und in Jugendzentren (u.a. in Castrop-Rauxel). Schließlich führte mich mein Weg an die Spitze des Bochumer Jugendamtes, dort war ich 18 Jahre lang als Leiter tätig. Immer habe ich gespürt, dass soziale Arbeit nur leistbar ist, wenn gute Beziehungen zu Kindern, Jugendlichen und ihren Familien aufgebaut werden. Vertrauen ist die Basis für Entwicklung. Dieses Vertrauen muss sich der Sozialarbeiter oft hart erarbeiten. Es geht aber nicht um ein kumpelhaftes Miteinander, sondern um einen respektvollen Umgang, der geprägt ist von Wertschätzung. Wer verächtlich auf soziale Randgruppen sieht, ist ungeeignet, Arbeit mit diesen zu leisten.
Soziale Arbeit aus der Distanz, per Videokonferenz oder lediglich vom Schreibtisch aus, kann meiner festen Überzeugung nach nicht gelingen. Immer geht es darum, auch persönlich durch vorbildhaftes Verhalten zu überzeugen. Natürlich gehört es zum pädagogischen Handeln, fachlich solide qualifiziert zu sein, sich ständig fortzubilden und sein eigenes Handeln kritisch reflektieren zu können.
Hatten Ihre persönlichen, subjektiven Erfahrungen in der praktischen Jugendarbeit Einfluss auf die Bearbeitung des historischen Stoffes?
Auf jeden Fall. Ich habe versucht den historischen Stoff so aufzuarbeiten, dass er einigermaßen allgemeinverständlich wurde. Mir war es beispielsweise wichtig, die Errungenschaften der oft ehrenamtlich geleisteten Jugendverbandsarbeit im Entwicklungsprozess der Kinder- und Jugendhilfe nicht auszublenden.
Wie schätzen Sie die Zukunft der Kinder- und Jugendarbeit ein?
Sie wird anders sein als in der Vergangenheit. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich zwar bereits in den letzten dreißig Jahren im ‚digitalen Zeitalter‘ grundlegend gewandelt. Doch die großen digitalen Veränderungen, die anstehen, nehmen erst jetzt in den Ämtern richtig Fahrt auf. Das wurde rasant bereits durch Corona deutlich und wird auch nicht mehr aufzuhalten sein: Home-Office, Videokonferenzen, Fortbildungen am Bildschirm werden den beruflichen Alltag auch in der Sozialarbeit weiterhin bestimmen. Aber welche Folgen hat diese Entwicklung auf die soziale Arbeit, in der ‚Beziehungsarbeit‘ und der direkte fachliche, kollegiale Austausch von existenzieller Bedeutung sind? Meines Erachtens gilt es zu vermeiden, dass die Kinder- und Jugendhilfe zersplittert und zerfasert, beliebig und belanglos wird. Sozialarbeit ist eben kein x-beliebiger Job. Immer muss klar sein, dass es letztlich in allen Feldern der Kinder- und Jugendhilfe um den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht. Bereits die Corona-Zeit machte deutlich, wie notwendig es ist, die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen kritisch im Auge zu behalten. Gewalt und sexueller Missbrauch finden in der Hauptsache im familiären Umfeld statt. Wenn Beziehungsarbeit der Sozialarbeiter zu Kindern und Jugendlichen abreißt oder unterbleibt, nur oberflächlich oder rein bürokratisch gearbeitet wird, bleiben Gefährdungsmomente und Tatbestände im Dunkeln und werden nicht erkannt. Das zeigten Beispiele der jüngeren Vergangenheit besonders deutlich (siehe Fall des massenhaften sexuellen Missbrauchs auf dem Campingplatz Lügde).
Außerdem: Die Ausweitung der Schulbetreuung hinterlässt vor allem im Bereich der ehrenamtlich geleisteten Jugendverbandsarbeit schon heute deutliche Spuren. Die Kindertagesbetreuung erhält zukünftig eine noch größere Bedeutung als bisher, weil hier die wichtigen Bildungsgrundlagen – auch im sozialen Lernen – vermittelt werden.
Welche Themen erwarten den Leser im zweiten Band?
Während ich im ersten Band die Geschichte der Kinder- und Jugendhilfe an praktischen Beispielen des östlichen Ruhrgebietes (Bochum, Castrop-Rauxel, Dortmund u.a.) bis 1945 dargestellt habe, geht es in Teil 2 um die autoritär geprägte Nachkriegsgeschichte, den Aufbruch der Schüler- und Studentenbewegung und die neuesten Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe bis in die Corona Zeit. Erzählt wird diese Geschichte anhand von Recherchen, diesmal allerdings ergänzt durch zahlreiche Interviews und Zeitzeugenberichte – sowohl von professionell arbeitenden Sozialarbeitern als auch von Betroffenen (z.B. in der Heimerziehung).
Ich habe die bundes- und landespolitischen Entwicklungen zwar anhand der gelebten Praxis im Jugendamt Bochum nachgezeichnet – glaube aber, dass dieser Stoff auch ganz allgemein für alle Menschen mit Bezug zum Thema interessant ist.